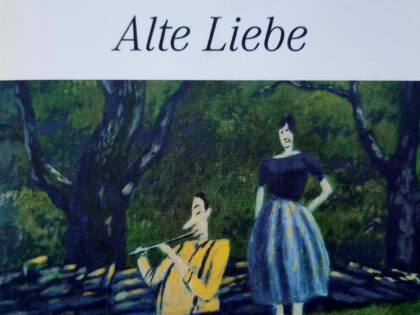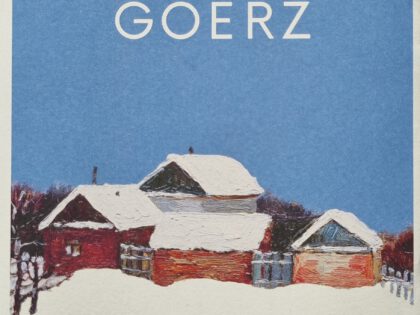Am Ende waren meine Erwartungen ganz offensichtlich zu groß.
“Schiffbruch mit Tiger“ wird aus der Ich-Perspektive von Pi Patel erzählt, einem Heranwachsendem, dem Sohn eines indischen Zoobesitzers (weshalb auch eine ziemlich ausführliche Fürsprache für Tierparks nicht fehlen darf). Pi ist Hindu, Christ und Muslim – und das ist ein Problem des Buchs: Es spielt für die Geschichte überhaupt keine Rolle. Der komplette erste Teil des Buchs handelt davon – nur wofür?? Es ist nett erzählt, kommt aber bei weitem nicht an „Gottes kleiner Krieger“ von Kiran Nagarkar heran, der eine ähnliche Geschichte sehr gekonnt erzählt hat.
Das eigentliche Buch beginnt also mit dem zweiten Teil, auf Seite 120, mit der Fahrt auf einem Frachter von Indien nach Kanada, inklusive Zoo. Der Frachter kentert, Pi kann sich retten, und mit ihm eine Hyäne, ein Orang Utan und Richard Parker. Richard Parker ist ein bengalischer Tiger.
“Japanischer Frachter Tsimtsun unter Panamaflagge, gesunken 2. Juli 1977, Pazifik, vier Tagesreisen von Manila. Sitze im Rettungsboot. Name Pi Patel. Habe etwas Nahrung, etwas Wasser, aber bengalischer Tiger ein ernstes Problem. Bitte Familie in Winnipeg, Kanada, benachrichtigen. Hilfe sehr erwünscht. Danke.“
Die Flaschenpost, die Pi nach mehreren Wochen auf See „entsendet“ hilft ihm auch nicht. Aber er hat mittlerweile gelernt zu überleben, auf einer kleinen selbst gebauten Rettungsinsel, die hinter dem Rettungsboot hergezogen wird. Denn dort herrscht der Tiger – und Pi versorgt ihn, um nicht selbst Opfer zu werden, mit Fischen und Schildkrötenfleisch. Er dressiert ihn sogar. 227 Tage überlebt Pi so.
„Alles löste sich auf. Alles wurde von der Sonne gebleicht und vom Wasser gegerbt. Das Rettungsboot, das Floß, bis es dann ganz verlorenging, die Plane, die Destillen, die Regensammler, die Plastiksäcke, die Leinen, die Decken, das Netz – alles wurde fadenscheinig, ausgeleiert, schlaff, rissig, trocken, morsch, zerschlissen, farblos. (…) Und die Sonne verbrannte alles. Immerhin hielt sie Richard Parker in Schach, zeitweise zumindest. (…) Wir siechten dahin.“
Man mag nicht glauben, dass die Geschichte eines Schiffbrüchigen in 227 Tagen auf hoher See ein ganzes Buch trägt. Doch das tut sie, ohne wirklich Längen zu produzieren. Es fasziniert, dass bei allem Irrsinn der Konstellation ein gewisses Maß an Realismus darin steckt: die Ausstattung des Rettungsboots, das vergebliche Auf-Sich-Aufmerksam-machen, als ein Frachter kreuzt …
Das Ende ist Überraschung, Ernüchterung, Empörung, Ungläubigkeit und die Wucht des Realen zugleich. Es führt vor Augen, dass man manchmal lieber eine gut erzählte Geschichte glaubt, als die nüchterne Realität. Oder ist es doch andersherum? Das bleibt dem Leser, der Leserin selbst überlassen.