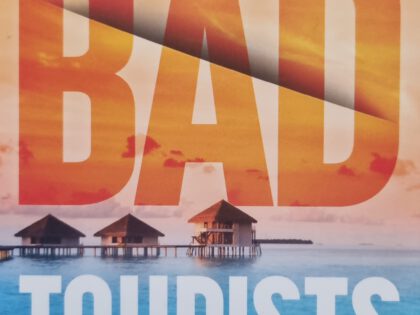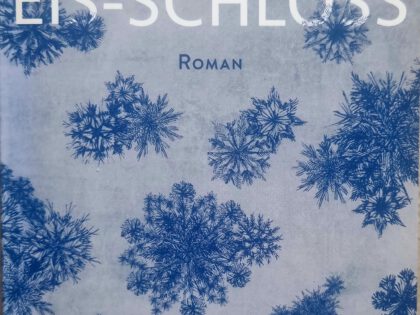Ben Givens, Herzchirurg im Ruhestand, will sich das Leben nehmen. Er hat Darmkrebs und will nicht durch die Krankheit dahinsiechen bis zum Tod. Deshalb will er zurück an den Ort seiner Kindheit, östlich von Seattle, östlich der Berge, und seinen Selbstmord wie einen Jagdunfall aussehen lassen. Seine Tochter soll nicht erfahren, dass er krank war, und deshalb einen anderen Tod gewählt hat.
Doch wie so oft kommt es auch hier anders als Ben denkt. Er hat einen Autounfall und ist auf die Hilfe eines jungen Pärchens angewiesen. Weil es nirgends einen Mietwagen gibt zieht er schließlich zu Fuß weiter, durch das Land, über Steppen und Hügel. Er jagt Vögel, schläft unter freiem Himmel, so, wie sein Bruder und er dies einst taten.
In Rückblicken, im THC-Rausch, nachdem Ben das erste Mal in seinem Leben einen Joint raucht, den ihm jemand unterwegs zusteckt, werden wichtige Passagen aus seinem Leben erzählt: Sein Heranwachsen, wie er seine inzwischen verstorbene Frau kennenlernte, die Jahre im Krieg …
Es kommt zu einer Konfrontation, seine Hunde drehen durch und jagen auf eigene Faust hinter einer Horde Wildhunde her. Ben wollte sie in die Wildnis entlassen; ein Mann, der seinem Leben ein Ende setzen will, muss sich eigentlich auch um nichts mehr kümmern. Doch die Verantwortung bleibt, auch einem Tier gegenüber. Ben kann nicht aus seiner Haut.
„Ihm kam der Gedanke, dass seine fieberhafte Sorge völlig unangemessen war. Welche Bedeutung konnte es für ihn in der nächsten Welt schon haben, ob er aufgab oder noch einmal versuchte, den Lauf der Dinge zu ändern? Er hatte gute Gründe, tatenlos zuzusehen. Es war nicht seine Pflicht, seine Hunde zu retten. Bald würde er sie ohnehin sich selbst überlassen müssen. Sollten sie doch ziehen, wohin es sie zog; danach würden sie ihn schon wiederfinden. Und wenn nicht, dann war das auch gut.
Aber aus langer Gewohnheit ging er weiter. Es waren weniger die Hunde als sein Gewissen, das ihn daran hinderte aufzugeben. Er wollte nicht fahrlässig handeln oder seine Pflichten vernachlässigen, er wollte sich selbst treu bleiben, sich selbst als Arzt, der sich um jede Einzelheit kümmerte, ein Mann, der seine Verantwortung im Leben ernst nimmt – und er stellte fest, daß es selbst im Schatten des Todes nicht leicht war, anders zu sein.“
Ben begegnet Menschen, zur richtigen Zeit, sie brauchen seine Hilfe. Das wird nicht melodramatisch ausgeschlachtet, es führt zu keiner Erkenntnis und keinem Entschluss, dass Ben im Leben noch gebraucht werden könnte. Doch es ist anrührend, vorbildlich.
David Guterson, der mit „Schnee, der auf Zedern fällt“ seinen Durchbruch feierte, schreibt schnörkellos und ohne Superlative. Wie er die Landschaft beschreibt, die Begegnungen, wie sein Protagonist Ben Givens mit Menschen umgeht, das ist einfach schön zu lesen, auf unaufgeregte Art bewegend. Die Krebserkrankung, der Wille zu sterben, das findet ohne Drama, ohne Übertreibung und ohne Kitsch und Klischee statt. Es sind nur wenige Tage, die Ben unterwegs ist, die beinahe ein Abenteuer sind, und die damit enden, dass er einfach wieder nach Hause kommt. Alles ist so wie es sein soll. Das Leben geht weiter. Große Literatur.