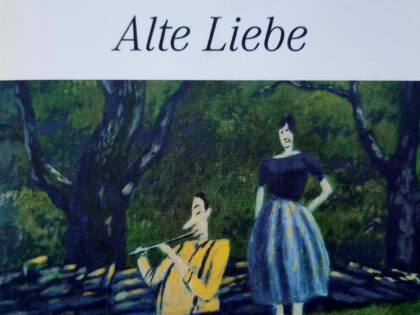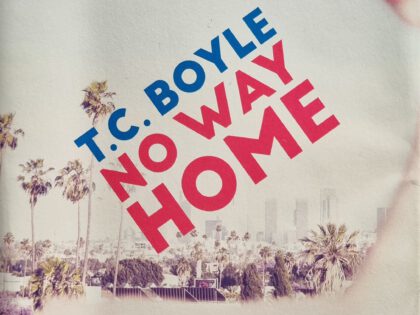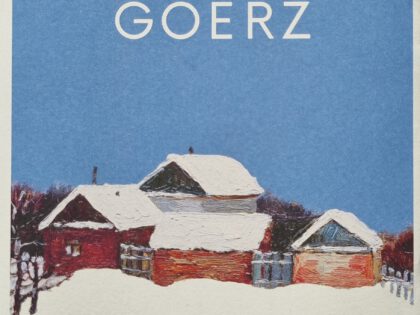Ich hatte etwas vollkommen anderes erwartet, angesichts des Titels und der Lobeshymnen, die auf dieses Buch geschrieben wurden. Ich dachte, es sei eher ein Sachbuch als ein Roman, oder zumindest ein Roman, der z.B. aus Sicht einer Biene erzählt ist – ähnlich Werbers „Die Ameisen“ (einem meiner Lieblingsbücher).
Doch „Die Geschichte der Bienen“ hat reichlich wenig mit der Geschichte der Bienen zu tun. Wenn Geschichte, dann vielleicht die der Imkerei – und das auch nur am Rande, bezogen auf die Art der Bienenhaltung.
Eigentlich geht es um drei Familien, die über arg konstruierte Stränge nur ganz wenig miteinander verbunden sind: der eine ist der UrurururuswGroßvater des nächsten, dessen Sohn ein Buch geschrieben hat, das Jahrzehnte später zum Standardwerk wurde und von der nächsten Protagonistin gelesen wird. Nun denn.
William lebt 1852 in England. Er lebt von einem Samengutgeschäft und mehreren Bienenstöcken. Das heißt, eigentlich vegetiert er vor sich hin, ist einer Depression erlegen, seit sein Professor sich über ihn lustig gemacht hat. Wie seine Frau die sechs Töchter und den Sohn über die Runden bringt, bleibt offen. Für William zählt einzig der Sohn, er soll eines Tages die Bienen übernehmen, soll stolz sein auf das, was sein Vater ihm vermacht hat. Er istSo ganz klappt das nicht.
George lebt 2007 in den USA, auch er lebt von Bienen. Er ist etwas „old fashioned“, wenn es um seine Bienenstöcke geht, baut die Beuten noch von Hand und ist überzeugt, dass die Bienen ihm das danken. Sein Nachbar Gareth hat längst auf industriell gefertigte Beuten umgestellt und fährt mit seinen Bienenstöcken durchs Land, um Obstbäume und Beerensträucher befruchten zu lassen.
„Alle, die sich mit Bienen auskannten, wussten, daß man mit Honig eigentlich nicht reich werden konnte. Auch Gareth hatte sein Vermögen nicht damit erwirtschaftet. Das große Geld lag in der Bestäubung, denn ohne Bienen war die Landwirtschaft aufgeschmissen. Meilen von blühenden Mandelbäumen oder Blaubeersträuchern waren unbrauchbar, wenn die Bienen die Pollen nicht von einer Blüte zur anderen trugen. Die Bienen konnten mehrere Kilometer am Tag bewältigen, viele tausend Blüten. Ohne sie waren die Blüten genauso nutzlos wie Teilnehmerinnen eines Schönheitswettbewerbs. Eine Weile lang schön anzusehen, auf längere Sicht aber ohne jeden Wert. Die Blüten welkten und starben, ohne Früchte zu tragen.“
Auch George hat einen Sohn, auch er will nichts mehr als dessen Stolz – und dass er den Hof übernimmt. Dumm nur, dass der lieber an der Uni Literatur studiert.
“Wir hatten nichts mehr von ihm gehört. Nichts über das Stipendium oder was er sonst plante. Vielleicht hatte er mit Emma telefoniert, während ich unterwegs war, und sie hatte es nicht erwähnt. Ich wartete einfach ab. Vielleicht überdachte er auch die verschiedenen Möglichkeiten, und keine Nachrichten waren gewissermaßen gute Nachrichten. Und er wusste schließlich, wo er mich erreichen konnte, es war ja nicht so, dass der Hof Flügel bekommen hatte und davongeflogen war. Hatte ich ihn verloren?“
Tao lebt 2098 in China. Sie arbeitet als Bestäuberin auf einer Obstplantage, wie so viele, denn Bienen gibt es nicht mehr. Den einzig freien Tag verbringt sie mit Mann und Sohn bei einem Picknick nahe der Obstbäume. Ihr Sohn spielt, und bekommt plötzlich Atemnot. Die Ärzte bringen ihn weg, bis nach Peking – und Tao muss sich auf eine lange Suche nach ihm machen.
Stellenweise hat mich dieses Buch richtig wütend gemacht. Die Charaktere sind nervtötend, vor allem die Männer. William und George sind völlig stereotyp, sich in ihrem Verhalten, ihren Erwartungen und Träumen viel zu ähnlich. Maja Lunde ist es nicht gelungen, die Entwicklung der Gesellschaft an den beiden deutlich zu machen; beide haben ein herrisches, trotziges, blindes Verhältnis zu ihren Söhnen, was unglaublich ermüdend ist.
Sie dienen lediglich dazu, Stationen der Imkerei darzustellen: Der eine, der eine neue Art der Beute entwickelt (allerdings zu spät, ein anderer war schneller). Der andere, um den Verlust der Bienen, der schon heute stattfindet, zu veranschaulichen. Das ist tatsächlich erschreckend – und doch in diesen Abschnitten der Gegenwart nicht eindrücklich genug dargestellt.
Das einzig wirklich Eindrückliche ist die Darstellung der Zukunft. Wie selbst ein systematisch organisiertes Land wie China, das in Sachen künstlicher Bestäubung schon früh aktiv wurde, kollabiert. Den Menschen geht es schlecht, es fehlt an Nahrung, die Bevölkerung schrumpft seit dem „Kollaps“. Was das ist, dieser Kollaps, wird erst sehr spät aufgelöst – und hängt ausschließlich mit dem Verlust der Bienen zusammen.
“Der Kollaps traf auch die sozialen Netzwerke. Innerhalb von drei Jahren brachen sie vollständig zusammen. Alles, was den Menschen blieb, waren Bücher, hakende DVDs, ausgeleierte Tonbänder, zerkratzte CDs mit abgelaufenen Programmen und das uralte, marode Fernleitungsnetz.
Warum aber? Was haben die Bienen mit dem Kollaps der Sozialen Medien zu tun? Das bleibt völlig unbeantwortet, dieser Zusammenhang wird nicht anschaulich und nachvollziehbar erklärt – da ging Maja Lunde dann wohl selbst die Phantasie aus.
Dass man aber zumindest anfängt, darüber nachzudenken – über das Ausmaß dessen, was Bienen bedeuten, was deren Verlust für Folgen hätte – das einmal praktisch darzulegen, jenseits der theoretischen Bedrohungsszenarien unserer Zeit, das ist meines Erachtens der einzige Grund, warum es sich lohnt, dieses Buch zu lesen.