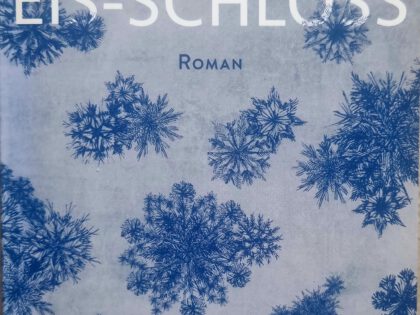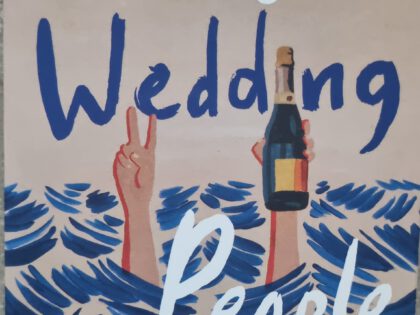Bevor das nächste Lesekreis-Buch ansteht wollte ich etwas zum schnell-runterlesen. Danach sah „Cheng“ aus und hat mich nicht enttäuscht. Aber ich bin etwas unwissend in diese Lektüre gestolpert, von der ich nicht mal wusste, dass sie österreichischen Schmäh at its best liefern würde. Sehr böse, sehr bissig, seeeehr gesellschaftskritisch. Dafür muss man in der Stimmung sein.
Die Handlung ist gar nicht so einfach auf den Punkt zu bringen. Kapitelweise mutet sie an wie in Träumen, von denen Cheng auch immer wieder mal geplagt wird. Doch auch das „reale“ Geschehen ist oft surreal verzerrt. Das ist einerseits abgefahren und stellenweise genial, andererseits verliert sich dadurch die eigentliche Erzählung.
Markus Cheng, gebürtiger Wiener mit chinesischer Abstammung, ist Privatdetektiv.
„… weder besaß er ein Chinalokal, noch spielte er Tischtennis, und so gut sein Deutsch war, so inexistent war sein Chinesisch, was bei in Österreich geborenen Menschen ja nicht unbedingt an ein Wunder grenzt. (…) Und wie die (sic!) meisten Menschen, die in Kagran aufwuchsen, war ihm Asien eher gleichgültig.“
Cheng arbeitet an einem einzigen Fall, und sein Klient ist bald tot. Eigentlich hätte sich damit auch für Cheng der Fall erledigt, würde er nicht ebenfalls bald von der Erscheinung einer rätselhaften Frau und ihren Nachrichten verfolgt, die immer etwas mit „St. Kilda“ zu tun haben. Eine Spur, die ins Nichts führt.
Cheng wird selbst Opfer dieser Frau, überlebt zur Überraschung des ermittelnden Oberstleutnant Straka zwar alle Angriffe, verliert dabei jedoch – soviel sei gespoilert – einen Arm. An dieser Stelle ist gerade mal ein Drittel des Buchs gelesen.
Letztendlich liefert der Autor auf den letzten Seiten eine Art Hau-Ruck-Aufklärung, zu der Cheng aber in keinster Weise beigetragen hat, im Gegenteil. Er ist zwar immer wieder mal anwesend, wenn in Verbrechen geschieht, tut aber nichts, um es zu verhindern. Dass dabei hanebüchene Zufälle (um nicht zu sagen: Unlogiken) eine Rolle spielen, ist einem im Verlauf dieser in sich schon hanebüchenen Erzählung ohnehin längst egal. (Dass ausgerechnet ich sowas schreibe, sagt viel über dieses Buch aus!)
Was aus meiner Sicht das unterhaltsame an „Cheng“ ist: der außerordentliche Sprachwitz und der vielerorts überzogene gesellschaftskritische Schmäh. Auf manchen Seiten strotzt jeder zweite Satz davon – nicht immer in den Zusammenhang passend, und manchmal für mich ein wenig too much. Aber ich bleibe immer wieder an Sätzen hängen, die zum Nachdenken anregen.
“Wenn er vor dem einfachen, schwarzen Grabstein stand, dann bemühte er sich um eine Empfindung, die aber nicht gelingen wollte. Und er bemühte sich um Erinnerungen, doch ihm glückten bloß Fotografien.“
“Menschen verschwinden, nichts regt Menschen weniger auf.“
“Der Applaus des wie üblich vom eigenen Applaus entzückten Publikums verlor sich in der Stille angestrengter Hustenunterdrückung.“
“Der Wiener ist übrigens der Überzeugung, dass man als Wiener nicht gleichzeitig ein Nazi sein kann, leidenschaftlicher Antisemit ja, katholischer Faschist ja, Demokrat ja, aber ein Nazi, das ist immer ein Deutscher.“
“Wenn ihm etwas unvergeßlich geblieben war, dann die Peinlichkeit der Doris Day (ihre monströse Hausmütterlichkeit wurde nur noch von der amerikanischen Wirklichkeit übertroffen).“
Ich habe dieses Buch gern gelesen und wundere mich selbst darüber. Es ist eine Aneinanerreihung abstruser Szenen, die oft in keinem Zusammenhang stehen. Wie die Aufführung einzelner Sketche, zusammengehalten durch den Protagonisten und seinen Hund Lauscher, einen tauben Dackel mit übergroßen Ohren. Sehr lesenswert für alle, die österreichischen Humor lieben! Mir persönlich reicht‘s erstmal, was aber nicht heißt, dass ich mir Chengs zweiten Fall nicht irgendwann noch zu Gemüte führe.
Im Übrigen war dem Autor wohl sehr bewusst, dass er an einigen Stellen auch über das Ziel der Polemik hinausgeschossen ist. Im Nachwort schreibt er:
„Daß diese literarische Figur bei ihrem ersten Auftreten in einer Comicwelt lebt, hängt nicht zuletzt damit zusammen, daß ich das Wien der neunziger Jahre exakt so empfunden habe: als ein böses Entenhausen. (…) Die Drastik des Dargestellten ist Prinzip einer quasi vorphilosophischen Zeit.“
Ich bin durchaus gespannt, wie sich dann der zweite Band liest …